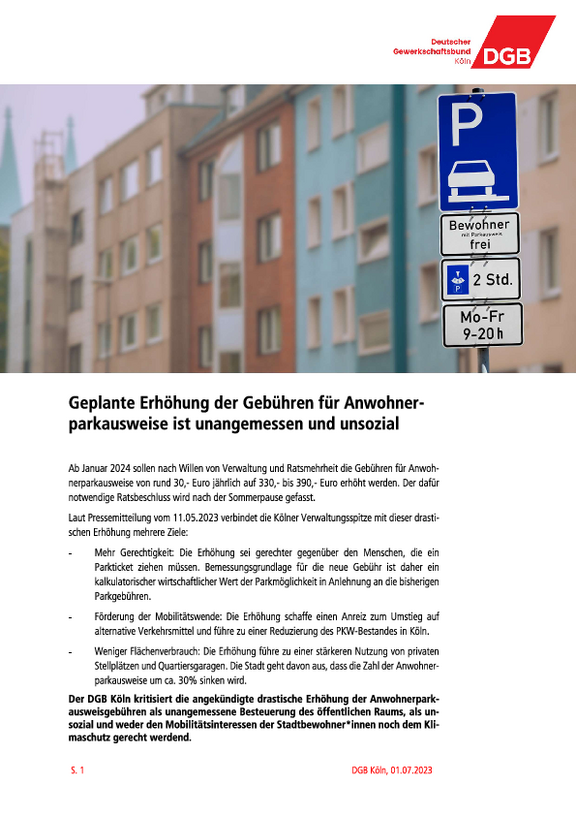Laut Pressemitteilung vom 11.05.2023 verbindet die Kölner Verwaltungsspitze mit dieser drastischen Erhöhung mehrere Ziele:
- Mehr Gerechtigkeit: Die Erhöhung sei gerechter gegenüber den Menschen, die ein Parkticket ziehen müssen. Bemessungsgrundlage für die neue Gebühr ist daher ein kalkulatorischer wirtschaftlicher Wert der Parkmöglichkeit in Anlehnung an die bisherigen Parkgebühren.
- Förderung der Mobilitätswende: Die Erhöhung schaffe einen Anreiz zum Umstieg auf alternative Verkehrsmittel und führe zu einer Reduzierung des PKW-Bestandes in Köln.
- Weniger Flächenverbrauch: Die Erhöhung führe zu einer stärkeren Nutzung von privaten Stellplätzen und Quartiersgaragen. Die Stadt geht davon aus, dass die Zahl der Anwohnerparkausweise um ca. 30% sinken wird.
Der DGB Köln kritisiert die angekündigte drastische Erhöhung der Anwohnerparkausweisgebühren als unangemessene Besteuerung des öffentlichen Raums, als unsozial und weder den Mobilitätsinteressen der Stadtbewohner*innen noch dem Klimaschutz gerecht werdend.
Unangemessene Besteuerung: Die Stadt verwandelt eine Bearbeitungsgebühr für die Ausstellung von Anwohnerparkausweisen in eine Besteuerung des öffentlichen Raums. Der Ausweis diente bis dato angesichts eines Mangels von Parkplätzen dem Schutz von Anwohner*innen in besonders belasteten Stadtgebieten. Die angekündigte drastische Preiserhöhung stellt demgegenüber eine Besteuerung von öffentlichen Raum für Autofahrer*innen dar. Da 87% aller Haushalte über mindestens einen PKW verfügen, finanzieren nahezu alle Haushalte über die allgemeinen Steuern sowie die autospezifischen Steuern (KfZ-Steuer, Mineralölsteuer) ohnehin diesen Teil des öffentlichen Raums (Parkplätze an öffentlichen Straßen). Ein Vergleich mit den Parkgebühren ist sachfremd, da auch diese wesentlich der Regulierung des Parkraums vor Geschäften und Institutionen dient.
Gebühr ohne Garantie: Ein Anwohnerparkausweis ist keine Garantie auf einen Parkplatz. Er ist nur ein “Los”, um an der “Lotterie” um einen der knappen Parkplätze in seinem Wohngebiet teilnehmen zu können. Die geplante Erhöhung bei gleichzeitig weiterer Verknappung des Parkraums wird letztlich dafür sorgen, dass die Betroffenen mehr Geld für eine noch geringere “Gewinnchance” ausgeben müssen.
Die unterschiedlichen Fallgestaltungen (Zeiten, für die das Anwohnerparkprivileg gilt) dürften zudem kaum einer rechtlichen Prüfung hinsichtlich der Gleichbehandlung standhalten. Gerade der für Anwohner*innen wichtige abendliche/nächtliche Schutz für Parkraum ist in den meisten ausgewiesenen Anwohnerparkzonen nicht gegeben. Anwohner*innen zahlt drastische Gebühren für diesen Zeitraum, der anderen Autofahrer*innen in dieser Zeit kostenlos zur Verfügung steht.
Sozial ungerecht: Die Erhöhung trifft Bewohner*innen von Mehrfamilienhäusern in den dicht besiedelten Stadtteilen Kalk, Lindenthal, Mülheim, Nippes, Porz, Ehrenfeld und Innenstadt. Dort gibt es kaum Möglichkeiten, PKWs auf eigenen Grundstücken abzustellen oder feste Stellplätze dauerhaft anzumieten. Bewohner*innen im Kölner Süden, die ebenfalls den öffentlichen Straßenraum als Abstellfläche nutzen, sind hingegen nicht betroffen. Das ist weder sozial noch gerecht. Man kann es auch drastisch formulieren: Wer in Kalk oder Mülheim wohnt, wird bestraft. Gleiches gilt für Haushalte mit geringen Einkünften, die sich die geplante Gebührenerhöhung nicht leisten können.
Soziale Ausgestaltung unmöglich: Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Grundsatzurteil vom 14.06.2023 deutlich gemacht, dass eine soziale Ausgestaltung der Kosten für Anwohnerparkausweise nicht rechtskonform ist. Weder eine Staffelung der Kosten nach Größe noch eine Ermäßigung oder ein Erlass der Gebühren aus sozialen Gründen sind rechtlich möglich.
Privatisierung des öffentlichen Raums: Die drastische Erhöhung der Anwohnerparkausweise führt letztlich zu einer weiteren Privatisierung des bislang öffentlichen Parkraums. Belastet werden vornehmlich Anwohner*innen in stark belasteten Innenstadtbereichen, profitieren wird die private Immobilienwirtschaft.
Fehlende Alternativen: Zudem fehlt es offensichtlich an attraktiven Angeboten, um die Mobilitätsanforderungen der Bewohner*innen zu erfüllen. Pendler*innen, die z.B. in Lindenthal wohnen und in Zündorf arbeiten, werden dies bestätigen. Der DGB Köln bezweifelt daher, dass die Gebührenerhöhung kurz- oder mittelfristig zu einer spürbaren Reduzierung des PKW-Bestandes führen wird. Sie belastet insbesondere Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, die auf einen PKW angewiesen sind. Die Erhöhung ist für viele Betroffene kein Anreiz zum Umstieg, wie von der Stadt angekündigt, sondern eine zusätzliche finanzielle Belastung, der sie nicht ausweichen können.
Keine Einschränkungen ohne Alternativen: Der DGB sieht die Notwendigkeit einer Mobilitätswende – gerade in einem Ballungsraum wie Köln. Er hat aber anlässlich der letzten Kommunalwahl darauf hingewiesen, dass Einschränkungen des motorisierten Individualverkehrs nur dann erfolgen können, wenn bedarfsgerechte Alternativen vorhanden sind. Gerade in den betroffenen Stadtteilen fehlt es an privatem Parkraum und Quartiersgaragen. Bei den Quartiersgaragen sehen wir die Stadt in der Pflicht, die notwendige Infrastruktur zu schaffen. Andernfalls werden gewinnorientierte Investoren die politisch gewollte Verknappung des öffentlichen Parkraums als neues Geschäftsmodell nutzen.
Einnahmen zu gering, um Mobilitätswende voranzutreiben: Die Gebührenerhöhung werden rund 15 Mio. Euro Einnahmen generieren, abzüglich Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten. Um diese Zahl einzuordnen: Das Defizit der KVB könnte in diesem Jahr von 145 auf bis zu 235 Mio. Euro steigen. Die Mehreinnahmen sind also ein Tropfen auf den heißen Stein. Mit den Nettoeinnahmen lassen sich jährlich nur kleinere Mobilitätswende-Maßnahmen realisieren.
Verknappung von Parkraum geht an den Bedürfnissen vieler Anwohner*innen vorbei: Das haben auch andere Städte erfahren, in denen der Wegfall von öffentlichen Parkplätzen zu Protesten von Anwohner*innen geführt hat. Der Wunsch nach mehr Freiflächen zur Verbesserung der Lebensqualität und einer neuen Raumaufteilung zugunsten des Rad- und Fußverkehrs konkurriert mit dem Wunsch nach wohnortnahen Parkmöglichkeiten. Dabei darf nicht übersehen werden, dass 87% aller Haushalte bundesweit über mindestens einen PKW verfügen - aus beruflichen, privaten oder gesundheitlichen Gründen. Parkraum ist somit kein Randthema. Er betrifft die weit überwiegende Zahl der Haushalte.
Anwohnerparkausweiserhöhung ignoriert Mobilitätstrends: Die Maßnahme wird von der Annahme getrieben, eine Mobilitätswende könne nur im Austausch von motorisierten Individualverkehr zugunsten des Umweltverbundverkehrs erfolgen. Die berufs-, arbeits-, familien – und freizeitbedingten Mobilitätsbedürfnisse lassen alle Mobilitätsformen anwachsen, darauf weisen die wachsende Ausstattung aller Haushalte mit Fahrrädern (ca. 3,2 Fahrräder pro Haushalt), mit Autos sowie Mobilitätstickets für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr (Bahncard, Deutschlandticket) ebenso hin wie die steigenden zurückgelegten KM pro Mobilitätsform. Für den Klimaschutz entscheidend wird daher für alle Verkehrsträger die Transformation zu emissionsfreien Antrieben, zur emissionsfreien Produktion der Verkehrsträger sein. Neben einem wachsenden ÖPNV-Angebot kommt deshalb auch dem bislang völlig unbefriedigenden Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität hohe Priorität zu. Steigende Kosten für individuelle Automobilität werden – nach den Erfahrungen der Pandemiezeit – nicht zu geringerer Automobilität führen, sondern die Finanzierung des ökologischen Umbaus im Wohn- und Konsumsektor gefährden.
Mehr Klimaschutz durch verbesserte Angebote für Pendler*innen: Um den Klimaschutz wirklich voranzubringen, müssen die großen CO²-Einsparpotentiale schneller gehoben werden. Dazu gehört vor allem eine Attraktivitäts- und Leistungsverbesserung beim ÖPNV und SPNV, damit mehr Pendler*innen ihren Arbeitsweg mit umweltfreundlichen Alternativen bewältigen können. Über 300.000 Berufstätige pendeln regelmäßig aus dem Umland zu ihrer Arbeitsstätte in Köln, zum Teil mit sehr weiten Entfernungen. Der mit Abstand größte Teil ist dabei noch auf eine PKW-Nutzung angewiesen. Ein gezielter Ausbau von ÖPNV- und SPNV-Angeboten einschließlich einer Park & Ride Infrastruktur inklusive Ladeinfrastruktur wäre ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Gleichzeitig ließe sich damit auch der Flächenverbrauch für das Vorhalten von Parkplätzen in der Stadt reduzieren.
Deswegen sprechen wir uns eindeutig gegen die geplante unangemessene Besteuerung von Anwohnerparkausweisen aus. Bis zum Aufbau tragfähiger Alternativen und der Entwicklung einer rechtssicheren sozialen Ausgestaltung muss die Gebühr für Anwohnerparkausweise das bleiben, was sie bisher ist – eine Bearbeitungsgebühr.